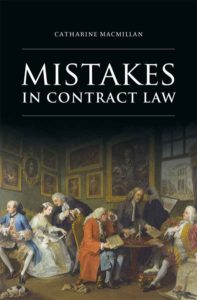 Wann immer Themen behandelt werden, die gerade als modern gelten, ist zu befürchten, dass der wissenschaftliche Ertrag gering und das Ausmaß an Zweitverwertung groß ausfällt. Bestenfalls werden hier altbekannte Argumente neu präsentiert, schlimmstenfalls kulturelle Reichtümer verschüttet und verfälscht. Genau solche Befürchtungen könnte man hegen, nimmt man MacMillans Buch in die Hand. Geht es doch dort um ein solches Modethema, nämlich das, was man heutzutage als Rechtstransplantat oder Rechtsexport bezeichnet. Konkret behandelt die Autorin die Einflüsse Pothiers und Savignys auf die Mistake-Doktrin im Common Law – ein gewisse Irrtümer erfassendes Rechtsinstitut, über dessen genauen Inhalt sich bis heute trefflich streiten lässt. Dass die Lektüre dennoch gleichermaßen spannend wie aufschlussreich ausfällt, liegt vor allem daran, dass sich MacMillan nicht in abstrakt-theoretisierenden Ausführungen verliert. Vielmehr untersucht sie die Übernahme fremder Rechtsvorstellungen „nur“ anhand eines klar umgrenzten Bereichs – dies dafür aber fundiert.
Wann immer Themen behandelt werden, die gerade als modern gelten, ist zu befürchten, dass der wissenschaftliche Ertrag gering und das Ausmaß an Zweitverwertung groß ausfällt. Bestenfalls werden hier altbekannte Argumente neu präsentiert, schlimmstenfalls kulturelle Reichtümer verschüttet und verfälscht. Genau solche Befürchtungen könnte man hegen, nimmt man MacMillans Buch in die Hand. Geht es doch dort um ein solches Modethema, nämlich das, was man heutzutage als Rechtstransplantat oder Rechtsexport bezeichnet. Konkret behandelt die Autorin die Einflüsse Pothiers und Savignys auf die Mistake-Doktrin im Common Law – ein gewisse Irrtümer erfassendes Rechtsinstitut, über dessen genauen Inhalt sich bis heute trefflich streiten lässt. Dass die Lektüre dennoch gleichermaßen spannend wie aufschlussreich ausfällt, liegt vor allem daran, dass sich MacMillan nicht in abstrakt-theoretisierenden Ausführungen verliert. Vielmehr untersucht sie die Übernahme fremder Rechtsvorstellungen „nur“ anhand eines klar umgrenzten Bereichs – dies dafür aber fundiert.
Ursprünglich war Mistake dem englischen Recht weithin unbekannt und tauchte nur ab dem 17. Jahrhundert ab und zu, mehr oder weniger zufällig, in der zunächst auch organisatorisch getrennten englischen Billigkeitsrechtsprechung (Equity) auf. Das davon geschiedene Common Law kannte weder Mistake noch spielten dort allgemeine Irrtumsargumente eine größere Rolle. Vielmehr klagte man nach prozedural stark ausgeformten und genau vorgegebenen Schritten, was wenig Platz für übergreifende inhaltliche Erwägungen ließ.
All dies änderte sich schrittweise im 19. Jahrhundert durch umfangreiche viktorianische Prozessrechtsreformen, die vor allem in den Judicature Act von 1873 mündeten. Nunmehr musste sich ein und dasselbe Gericht sowohl mit dem Common Law als auch mit Equity beschäftigen. Noch viel wichtiger war allerdings eine weitere Auswirkung dieser Reformen: So schnitt man die höchst komplizierten und stark formalisierten Anforderungen an eine Klageerhebung zurück. Dies erleichterte es wiederum, das materielle Recht überhaupt als einen eigenständigen Bereich wahrzunehmen und von dessen prozessualer Durchsetzung stärker zu trennen. Dann aber lag es auch nahe, viele Gesichtspunkte, die bisher in verschiedensten formalen Anforderungen auftauchten, zu verallgemeinern. Es waren also prozessuale Veränderungen, die erst das erleichterten, was im restlichen Europa schon seit geraumer Zeit betrieben wurde, nämlich eine verallgemeinernde und damit wissenschaftliche Erfassung des geltenden Rechts. Ja, diese Reformen forderten geradezu auf, dies zu tun, da auch die Praxis auf einmal stärker nach überzeugenden Argumenten und stimmigen Einordnungen fragte. Denn so ließen sich diejenigen neuen Spielräume ausnutzen, die das zurückgeschnittene Prozessrecht hinterlassen hatte.
In genau diese Lücke stießen Autoren wie Anson (The Principles of the English Law of Contract, 1884), Benjamin (Treatise on the Law of Sale of Personal Property, 1868), Fry (A Treatise on the Specific Performance of Contracts, 1858) oder Pollock (The Principles of Contract at Law and Equitiy, 1876), die sich um eine stärkere Systematisierung des englischen Rechts bemühten. Doch beschäftigte sich damals in England kaum jemand dogmatisch mit dem dort geltenden Recht. Demgegenüber fand sich im restlichen Europa an zahllosen juristischen Fakultäten eine an immer mehr an Breite und Niveau gewinnende Diskussion. Es war daher wohl geradezu zwangsläufig, dass die vorgenannten Autoren – von ihrer Heimat gewissermaßen im Stich gelassen – auch über den Ärmelkanal schielten.
Zum einen bediente man sich hier bei Pothier, der nicht nur vergleichsweise klar und systematisch schrieb, sondern sich auch gut im römischen Recht auskannte. Dabei vertraute man weitestgehend dessen Interpretationen, anstatt die römischen Quellen selbst zu studieren und einzuordnen. Genauso sah man darüber hinweg, dass Pothier die Irrtumsproblematik – obwohl für das englische Rechtsdenken eigentlich nur schwer verdaulich – stark subjektiv dachte. Ganz ähnlich verhielt es sich mit Savigny. Die englischen Gerichte wiederum zeigten sich diesen neuen Ideen zunächst wenig aufgeschlossen. Erst im Jahr 1931 erkannten sie die Mistake-Doktrin endgültig an, und zwar vor allem unter dem Eindruck der zuvor genannten englischen Traktakte.
In der Bewertung dieser Vorgänge zeigt sich die Autorin alles andere als begeistert und kann dafür durchaus handfeste Gründe liefern. So verlief bereits die Übernahme fremder Ideen unglücklich. Nicht nur ging man äußerst selektiv – man könnte auch sagen: willkürlich – vor, was schon deshalb bedenklich ist, weil Irrtümer in engem Zusammenhang mit ganz anderen Instituten stehen. So wirkte sich etwa die Unwirksamkeit eines Vertrags in England sehr viel gravierender aus, da hier die Rückabwicklung deutlich schwächer ausgestaltet war als anderswo. Daneben ignorierte man die gesamte Diskussion in Frankreich und Deutschland, welche die Erkenntnisse von Pothier und Savigny schnell überholte. Nicht einmal der Code Civil und dessen Anwendung durch die französischen Gerichte interessierten. Schließlich bildeten die fremden Ideen nicht nur wegen ihrer subjektiven Ausrichtung einen Fremdkörper. Genauso verdrängte man funktional vergleichbare englische Rechtsinstitute (extensive Auslegung, misrepresentation etc.), die sich durchaus hätten ausbauen lassen. Eine gewisse Ironie bildet bei all dem, dass ausgerechnet Savigny zu diesen Friktionen beitrug. Schließlich war es die historische Schule, die so treffend betonte, dass Recht nicht etwa apriorisch ist, sondern kulturell-dynamisch gewachsen und damit stark mit regionalen Überzeugungen, Bräuchen und Rechtsvorstellungen verknüpft.
Was können wir aus alldem lernen? Auch wenn es nicht unbedingt diejenige Konsequenz ist, die MacMillan zieht, verdeutlicht die Mistake-Doktrin sehr schön, dass jede Rechtsordnung auf eine fortwährende wissenschaftliche Begleitung angewiesen ist. Tatsächlich kann sich angesichts unserer begrenzten geistigen Fähigkeiten niemand – auch kein Common Law-Richter – dem Zwang entziehen, Recht verallgemeinernd zu erfassen und damit Rechtsdogmatik zu betreiben. Das einzige, worüber wir entscheiden können, ist, ob wir diese Dogmatik rein willkürlich, unreflektiert und damit regelmäßig fremdgesteuert betreiben, oder aber ein größtmögliches, eben wissenschaftliches, Niveau anstreben. Man kann also nur hoffen, dass die von MacMillan so schön analysierte Geschichte der Mistake-Doktrin auch zu den richtigen Schlüssen Anlass gibt.
