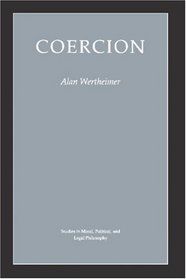 Glaubt man gängigen Lehrbüchern zum Vertragsrecht, so interessiert die Drohung nur am Rande – im deutschen Recht etwa als ein Anfechtungsgrund von vielen. Dabei berührt dieses Phänomen nicht nur die Fundamente jedes Vertrags, sondern reicht noch weit darüber hinaus. Denn letztlich berühren Zwang und Drohung die ganz grundlegende Legitimation staatlicher Gewalt. Zwingt und bedroht uns nicht eigentlich auch der Staat mit all seiner Macht? Schließlich geht es selbst um so ethisch aufgeladene Konzepte wie Schuld, Verantwortung oder Freiwilligkeit, von deren Vorliegen Zwang und Drohung nach verbreitetem Verständnis befreien. Dabei macht es die Sache sicher nicht leichter, wenn klassische Vertragstheorien wie die Willens- oder die Erklärungstheorie zu diesen Fällen wenig zu sagen haben – schließlich weiß der Bedrohte meistens ganz genau, was und wie ihm gerade geschieht. Und wenn es dann noch seit alters „coactus voluit“ heißt, so fragt man sich umso verwirrter, warum wir es denn eigentlich missbilligen, wenn der bewaffnete Räuber sein Opfer mit vorgehaltener Waffe davon überzeugt, ihm das Geld auszuhändigen. Kurzum, man kann Wertheimer jedenfalls nicht vorwerfen, ein langweiliges oder praktisch bedeutungsloses Thema gewählt zu haben.
Glaubt man gängigen Lehrbüchern zum Vertragsrecht, so interessiert die Drohung nur am Rande – im deutschen Recht etwa als ein Anfechtungsgrund von vielen. Dabei berührt dieses Phänomen nicht nur die Fundamente jedes Vertrags, sondern reicht noch weit darüber hinaus. Denn letztlich berühren Zwang und Drohung die ganz grundlegende Legitimation staatlicher Gewalt. Zwingt und bedroht uns nicht eigentlich auch der Staat mit all seiner Macht? Schließlich geht es selbst um so ethisch aufgeladene Konzepte wie Schuld, Verantwortung oder Freiwilligkeit, von deren Vorliegen Zwang und Drohung nach verbreitetem Verständnis befreien. Dabei macht es die Sache sicher nicht leichter, wenn klassische Vertragstheorien wie die Willens- oder die Erklärungstheorie zu diesen Fällen wenig zu sagen haben – schließlich weiß der Bedrohte meistens ganz genau, was und wie ihm gerade geschieht. Und wenn es dann noch seit alters „coactus voluit“ heißt, so fragt man sich umso verwirrter, warum wir es denn eigentlich missbilligen, wenn der bewaffnete Räuber sein Opfer mit vorgehaltener Waffe davon überzeugt, ihm das Geld auszuhändigen. Kurzum, man kann Wertheimer jedenfalls nicht vorwerfen, ein langweiliges oder praktisch bedeutungsloses Thema gewählt zu haben.
Dabei unterlässt es dieser Autor nicht, schnurstracks auf das zuzumarschieren, was gewissermaßen des Pudels Kern bildet: die jeweilige rechtliche Ausgangslage, auf deren Basis der Drohende seinem Kunden anbietet, ihn gegen Geld weiter leben zu lassen. Denn dass wir dies nicht als Austausch, als Angebot oder gar als ein Schnäppchen einordnen, liegt allein daran, dass nach unserer Rechtsvorstellung dem Bedrohten ohnehin schon Leben wie Geld gehören. Anders als bei üblichen Verträgen geht es ihm hier also hinterher nicht besser, sondern er verschlechtert sich in Höhe des zu zahlenden Geldbetrags. Mit dieser Einsicht in die fundamentale Bedeutung der rechtlichen Ausgangslage muss Wertheimer nicht einmal Neuland betreten (wie er selbst darlegt). Denn nicht nur die Rechtsprechung dies- wie jenseits des Atlantiks beherzigt diese Einsicht im Ergebnis schon immer. Auch die Wissenschaft kam dem bereits seit langem auf die Spur – im englischen Sprachkreis spätestens durch den so schlauen Robert Nozick. Überwiegend wird eher darüber diskutiert, was genau denn als Referenz („baseline“) zu gelten habe: Ist es wirklich die jeweilige Rechtslage, sind es moralische Vorstellungen oder gar nur die üblichen Verhältnisse?
Vertragstheoretisch ist diese Thematik vor allem deshalb so spannend, weil die jeweilige Rechtslage ersichtlich nicht im Tatbestand all derjenigen Theorien auftaucht, die wir üblicherweise bemühen. Vielmehr sind diese hochgradig punktuell, indem sie allein auf das Parteiverhalten bei Vertragsschluss abstellen, sei es in Form einer äußeren Erklärung oder auch bloß subjektiver Vorstellungen. Wie verhält sich das mit dem, was uns hier Zwang und Drohung lehren? Die Antwort fällt ernüchternd aus. Wohl um die punktuelle Vertragssicht wenigstens begrifflich selbst dort noch aufrechtzuerhalten, wo sie offensichtlich versagt, weichen wir Juristen auf so schillernde Begriffe wie Entscheidungsfreiheit, Willensfreiheit oder Freiwilligkeit aus. Leider konnte hier noch niemand überzeugend darlegen, wie man deren Vorliegen überprüft. Wie soll ein Richter „Entscheidungsfreiheit“ feststellen und nicht einfach nur behaupten? Immerhin beschreibt Wertheimer einige interessante, wenn auch letztlich nicht treffende Konkretisierungsversuche – etwa indem man auf die Anzahl, Zumutbarkeit oder sonstige Qualität verfügbarer Handlungsalternativen abstellt.
Übergreifend betrachtet tritt Wertheimer zwar nicht gerade eine wissenschaftliche Revolution los, ergründet aber ein dogmatisch äußerst spannendes Problem auf sehr angenehme Weise, weil nicht nur gründlich und umfassend, sondern auch – für englischsprachige Literatur durchaus typisch – unterhaltsam und auf einer dem Thema angemessenen Abstraktionshöhe. Und obwohl er ähnlich wie seine Vorarbeiter zu diesem Gebiet mit letztlich philosophischem Anspruch schreibt, ist er sich nicht zu schade, zunächst sehr eingehend die umfangreiche Rechtsprechung zu analysieren und dabei unumwunden einzugestehen, dass es auch rein philosophisch wenig überzeugend wäre, sich von der dort über viele Jahre etablierten Praxis grundlegend zu entfernen.
Dabei ist Wertheimer dann auch noch so großzügig, uns einige drängende Fragen zurückzulassen, die weder er noch seine Mitstreiter befriedigend lösen konnten. Denn so richtig und wichtig die Erkenntnis auch ist, dass wir Verträge immer auf Basis einer gegebenen Rechtslage beurteilen, benötigen wir erst einmal eine insgesamt schlüssige Vertragstheorie, die genau das dann auch tatbestandlich integriert – und zwar mit für das gesamte Vertragsrecht tragfähigen Ergebnissen. Außerdem verlagert man so zunächst nur die Frage nach Zwang oder Drohung auf die einer Bestimmung der jeweiligen Rechteausstattung, benötigt also zumindest außervertragliche Kriterien bzw. rekursive Elemente, um nicht in einen Zirkelschluss zu verfallen. Ebenso bleiben sämtliche Fälle unerklärt, in denen sich das Opfer auf Basis seiner rechtlichen Ausgangslage zwar noch marginal verbessert, dafür aber einen nach unserer Auffassung viel zu hohen Preis zahlt (sog. Ausbeutung).
